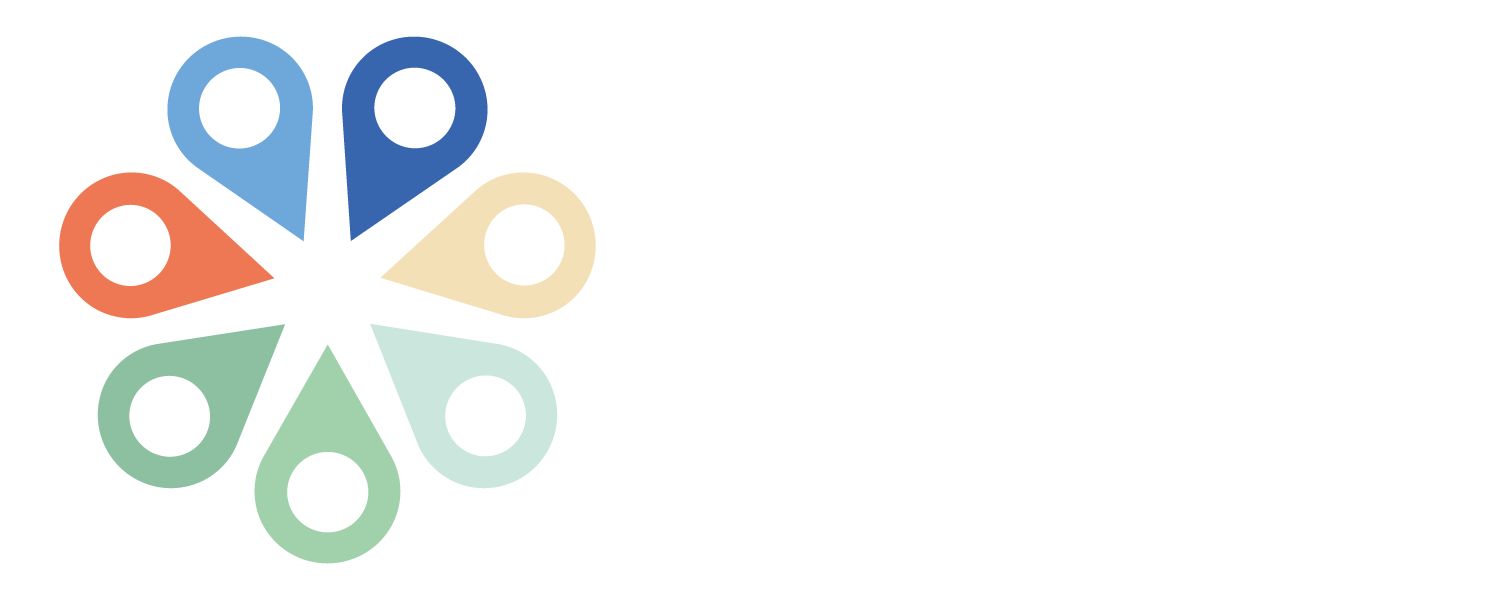Derzeit beugen sich viele über den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD, um zu verstehen, mit welcher Programmatik die neue Regierung in den kommenden vier Jahren Politik gestalten möchte. Zwar ist die rechtliche Verbindlichkeit von Koalitionsverträgen ebenso fraglich wie die tatsächliche Umsetzung der dort vereinbarten Vorhaben. Denn allzu oft konnten wir in der Vergangenheit beobachten, dass sich Koalitionsverträge zumindest in Teilen rasch überholt hatten – etwa aufgrund unerwarteter externer oder interner Entwicklungen wie Kriege oder eine Pandemie. Nichtsdestotrotz lässt sich aus dem vorliegenden Koalitionsvertrag ein gewisser „Mindset“ des schwarz-roten Projekts herauslesen. Auch zur (digitalen) Bürgerbeteiligung?
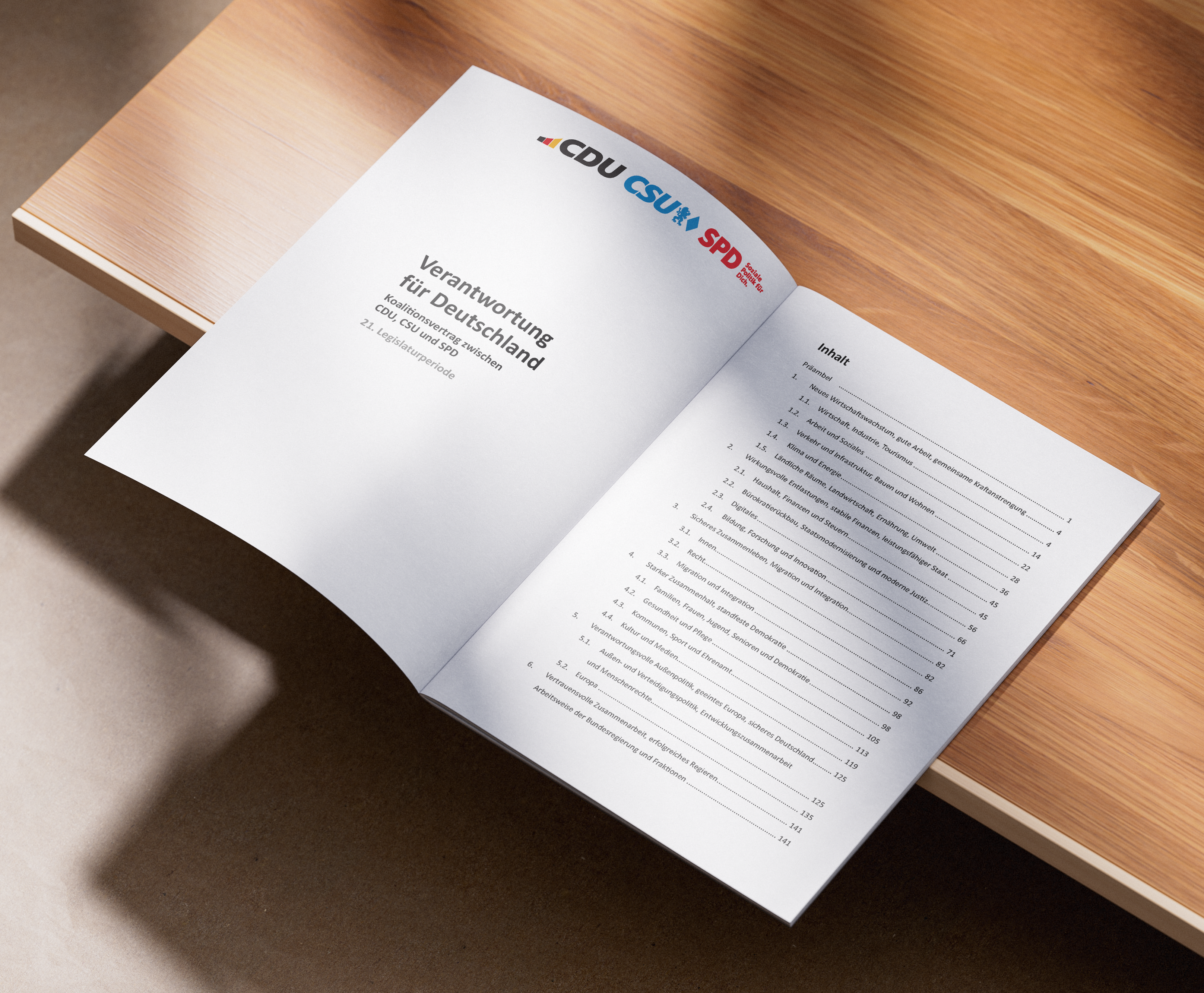
Auf den ersten Blick findet sich im Text wenig bis nichts zu diesem Thema. Zwar taucht der Begriff „Beteiligung“ rund 30 Mal auf, jedoch meist in anderen Kontexten – etwa im Zusammenhang mit „Mitarbeiterkapitalbeteiligung“. Der spezifische Begriff „Bürgerbeteiligung“ erscheint auf keiner der rund 145 Seiten.
Die unmittelbare Beteiligung der Bürger:innen an politischen Entscheidungen wird im Vertrag lediglich an einer Stelle erwähnt – in Form der „Öffentlichkeitsbeteiligung“ im Rahmen von Planfeststellungsverfahren. Im Abschnitt „Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung“ heißt es: „Die Plangenehmigung soll zum Regelverfahren werden. Beteiligungen der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit sowie Prüfungen finden nur einmal statt.“ In diesem Framing deutet sich ein unterstellter Zielkonflikt an – zwischen der Einbindung der Bürger:innen auf der einen Seite und der Beschleunigung von Verfahren auf der anderen. Also: Mehr Bürgerbeteiligung, weniger Effizienz?
Im Vergleich dazu atmete der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition einen anderen Geist. Unter der identischen (!) Abschnittsüberschrift war dort zu lesen, dass die Bundesregierung ihre Kompetenz zur Unterstützung dialogischer Bürgerbeteiligungsverfahren ausbauen wolle. An anderer Stelle war von einer „guten, frühzeitigen Bürgerbeteiligung“ die Rede oder davon, dass man „Bürgerbeteiligung in Verantwortung der kommunalen Selbstverwaltung unterstützen“ wolle. All dies ließ eine partizipatorische Wende erwarten.
Entscheidend ist letzten Endes „auf dem Platz“ – das galt für den alten wie für den neuen Koalitionsvertrag. Es ist zu vermuten, dass zukünftig eine Ausweitung von Beteiligungsmöglichkeiten und -formaten in einem Spannungsverhältnis zum Ziel der Entbürokratisierung und Beschleunigung von Entscheidungsverfahren gesehen wird und insofern in den nächsten Jahren schlechte Karten haben wird.
Wenngleich somit die Zeichen der Zeit für eine verstärkte Beteiligung von Bürger:innen mit Blick auf den Koalitionsvertrag nicht gut stehen – die Digitalisierung ist für die neue Regierung durchaus zentral; sie nimmt im Koalitionsvertrag viel Raum ein und erhält sogar erstmalig ein eigenes Ministerium. Und gerade darin liegt eine Chance auch für die Bürgerbeteiligung: Betroffene effizient einzubinden, ohne Entscheidungsprozesse unnötig zu verlängern, ist durch gut gemachte digitale Verfahren möglich. Eine digitalisierte Bürgerbeteiligung steht der Verfahrensbeschleunigung nicht entgegen. Allemal sorgt die Einbindung der Betroffenen – durchaus im Sinne der Effizienz – dafür, dass die Entscheidungsprozesse und ihre Ergebnisse am Ende auf höhere Akzeptanz stoßen können und womöglich auch sachdienlicher sind, weil das Wissen der Betroffenen eingepreist worden ist. Mehr digitale Beteiligung würde nicht zuletzt zur Steigerung der Verfahrensqualität beitragen und zu einer schnelleren Umsetzung der Entscheidungen, ganz nach dem Motto „Beschleunigung durch Beteiligung“.

Prof. Dr. Stefan Marschall
Lehrstuhlinhaber für Politikwissenschaft
Prof. Dr. Stefan Marschall ist seit 2010 Inhaber einer W3-Professur für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit dem Schwerpunkt „Politisches System Deutschlands“. Von 2019 bis 2024 war er zudem als Prorektor für Internationales und Wissenschaftskommunikation tätig. Zuvor bekleidete er eine W2-Professur an der Universität Siegen und vertrat Professuren unter anderem an der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Universität Duisburg-Essen.
Seine Habilitation legte er 2004 an der Universität Düsseldorf ab, wo er zuvor als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent gearbeitet hatte. Sein Studium absolvierte er an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sowie an der University of Pittsburgh in den USA.