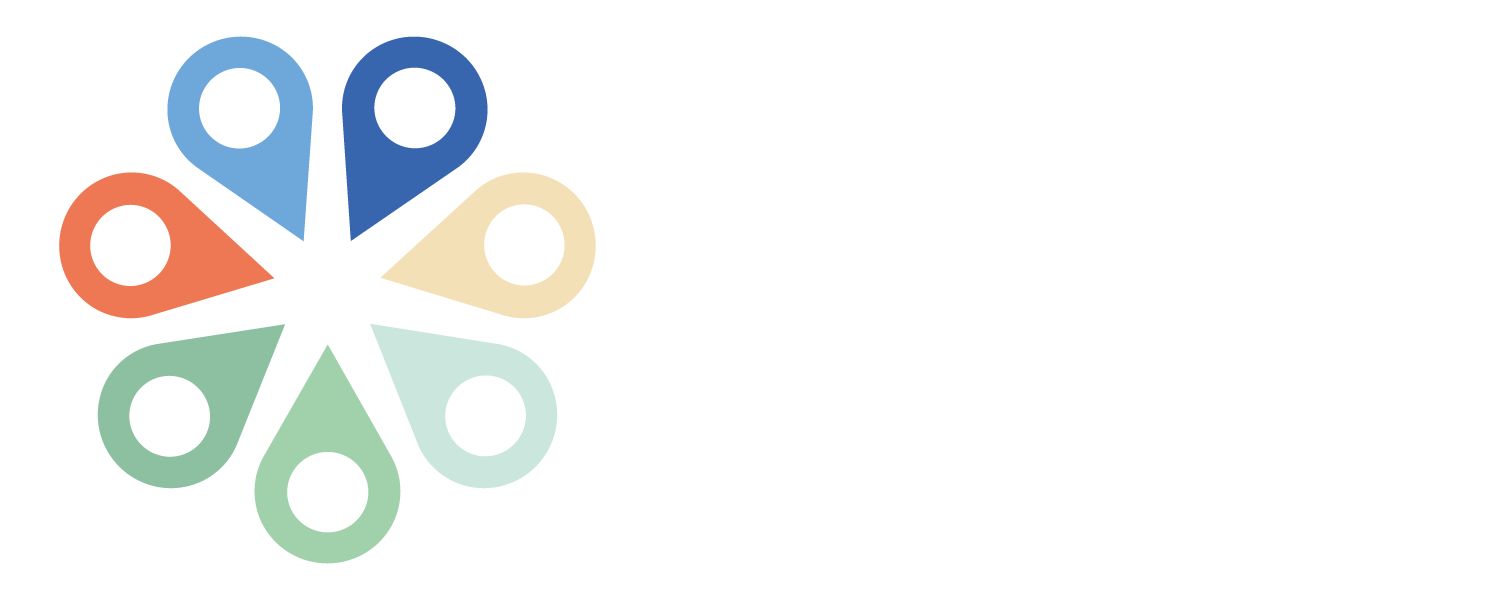Die digitale Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist ein Schlüsselthema in der kommunalen Entwicklung, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Räumen. Doch während die Digitalisierung in urbanen Gebieten weit fortgeschritten ist, gibt es in ländlichen Regionen noch erhebliche Herausforderungen. Das Forschungsprojekt DigiBeL hat sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie digitale Ansätze die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an regionalen Entwicklungsprozessen verbessern können und wie sich analoge und digitale Formate sinnvoll kombinieren lassen.
Methoden und Untersuchungsgebiete
DigiBeL verfolgte einen dreistufigen Forschungsansatz:
- Eine umfassende Literaturauswertung von Artikeln in 290 Fachzeitschriften mit Peer Review legte den Grundstein.
- Eine bundesweite quantitative Befragung von Praxisakteurinnen und -akteuren lieferte weitere Erkenntnisse.
- Die Ergebnisse wurden in sechs regionalen Fallstudien in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Brandenburg und Schleswig-Holstein qualitativ vertieft.
Diese empirischen Untersuchungen zeigten erhebliche regionale Unterschiede in der Nutzung digitaler Beteiligungsformate. Während einige Regionen noch am Anfang stehen, sind andere bereits weiter fortgeschritten und haben digitale Beteiligung in umfassendere Strategien integriert.
Digitale Formate der Bürgerbeteiligung
Die Analyse ergab drei Hauptformen digitaler Beteiligung:
- Digitale Transformation analoger Formate – Durch die Corona-Pandemie wurden viele klassische Beteiligungsformate in den digitalen Raum verlagert, z. B. digitale Ideenworkshops oder Online-Versammlungen.
- Gezielte digitale Tools – Viele Regionen nutzen digitale Werkzeuge für spezifische Funktionen, etwa Online-Umfragen oder interaktive Regionskarten.
- Komplexe digitale Beteiligungsverfahren – Einige Regionen setzen umfassendere digitale Plattformen ein, die verschiedene Funktionen wie Informationsbereitstellung, Vernetzung und Mängelmeldungen bündeln.
Hybride Formate, also die Kombination von analogen und digitalen Beteiligungsmöglichkeiten, sind bislang selten, werden aber als vielversprechend betrachtet.
Herausforderungen und Erfolgsfaktoren
Eine zentrale Erkenntnis des Forschungsprojekts ist, dass digitale Beteiligung nicht alle Zielgruppen gleichermaßen erreicht.
- Zielgruppenorientierung ist entscheidend: Klischees wie eine generelle “Technikaversion” älterer Menschen oder die einfache digitale Erreichbarkeit jüngerer Generationen greifen oft zu kurz. Weitere Faktoren wie Mobilität, Sprachbarrieren und digitale Kompetenz spielen eine Rolle.
- Multiplikatoren und Vertrauenspersonen können helfen, digitale Beteiligung bekannter und akzeptierter zu machen.
- Technische Infrastruktur und Ressourcen bleiben eine Herausforderung: In vielen Regionen fehlt es an schnellem Internet, Endgeräten oder finanziellen Mitteln zur Umsetzung digitaler Beteiligungskonzepte.
- Nachhaltige Beteiligungskultur: Die Forschung zeigt, dass digitale Beteiligung besonders dann erfolgreich ist, wenn sie niedrigschwellig zugänglich ist und in den Alltag integriert wird, z. B. durch digitale Bürgerportale.
Fazit und Handlungsempfehlungen
Digitale Beteiligung kann ein wirkungsvolles Instrument zur Stärkung der regionalen Entwicklung sein, wenn sie bedarfsgerecht gestaltet wird. Dabei sollte eine sinnvolle Verzahnung von analogen und digitalen Formaten erfolgen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Wichtig ist eine transparente Kommunikation über Ziele und Wirkung der Beteiligung sowie eine enge Verzahnung mit lokalen Akteuren und Verwaltungseinrichtungen.
Zukunftsweisend sind Ansätze, die digitale und analoge Elemente miteinander verbinden, um Barrieren abzubauen und eine inklusive Beteiligungskultur zu etablieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Bevölkerungsgruppen in die Gestaltung ihrer Region einbezogen werden.
Literaturverzeichnis
Stein, Veronika; Pentzold, Christian; Peter, Sarah & Sterly, Simone (2025): Digital Political Participation for Rural Development: Necessary Conditions and Cultures of Participation. The Information Society, 41(1), 18-32. https://doi.org/10.1080/01972243.2024.2407339

Prof. Dr. Chrstian Pentzold
Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Leipzig und Ko-Direktor des Center for Digital Participation
Prof. Dr. Christian Pentzold ist seit 2020 Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Leipzig und Ko-Direktor des Center for Digital Participation. Zuvor war er Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der TU Chemnitz und von 2016 bis 2019 Juniorprofessor an der Universität Bremen. Seine Forschung führte ihn an renommierte Institutionen wie das Oxford Internet Institute, das Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard Law School, das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin und das King’s College London. Im akademischen Jahr 2021/2022 war er Lady Davis Fellow an der Hebrew University in Jerusalem.